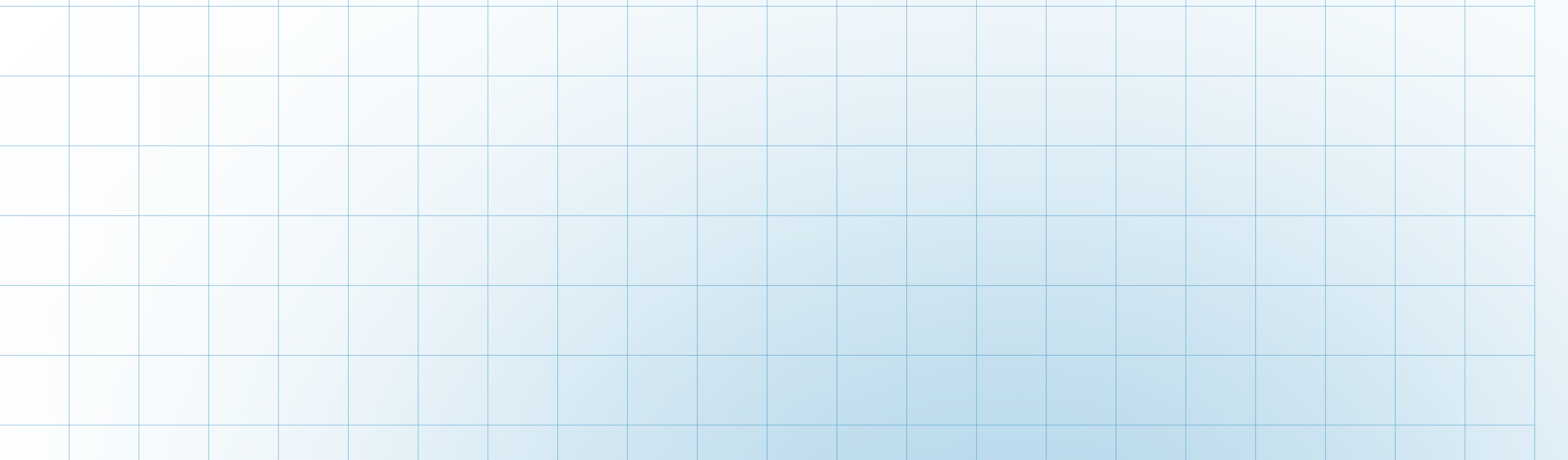Das BIM-Labor der Technischen Hochschule Köln ist ein hochmodernes Zentrum für die Weiterentwicklung von BIM. Es bündelt Forschung, Lehre und Praxis – mit Fokus auf den gesamten Lebenszyklus von Bauwerken, insbesondere im Brücken- und Ingenieurbau. Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Praxispartner finden hier eine leistungsstarke Infrastruktur für praktische und wissenschaftliche Arbeit. Wir haben mit Prof. Dr. Niels Bartels, dem stellvertretenden Laborleiter gesprochen, um mehr über dieses spannende BIM-Zentrum zu erfahren.
Das Labor versteht sich als Ort interdisziplinärer Zusammenarbeit: Die Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik kooperiert eng mit der Architektur und Technischen Gebäudeausrüstung (TGA), die an der TH Köln in anderen Fakultäten angesiedelt sind. Dieser Austausch wird unter anderem durch den „BIM Hub“ gefördert – eine Lehr- und Lernplattform, auf der Studierende aus verschiedenen Disziplinen gemeinsam modellbasiert arbeiten.
Neben stationären Workstations mit aktueller BIM-Software wie Revit, Allplan, Solibri oder DESITE md steht auch das sogenannte „BIM-Mobil“ zur Verfügung – ein mobiler Arbeitsplatz mit Long Term Evolution (LTE)-Router, Tablets und Hochleistungsrechnern. Damit können unter anderem modellgestützte Bauwerksprüfungen von Brückenbauwerken direkt vor Ort durchgeführt werden – beispielsweise an Brücken, wie Prof. Niels Bartels, stellvertretender Laborleiter, berichtet. Er ist gemeinsam mit Prof. Dr. Markus Nöldgen (Laborleiter) und Kristina Hahne (Laboringenieurin) Ansprechpartner für das BIM-Labor.
Herausforderungen bei der Integration von BIM im Brücken- und Ingenieurbau
Prof. Bartels betont die technischen Herausforderungen im Zusammenspiel verschiedener Softwarelösungen: Insbesondere bei fakultäts- oder hochschulübergreifenden Projekten seien nicht vollständig umgesetzte offene Datenformate wie Industry Foundation Classes (IFC) oft ein Stolperstein. Da mit verschiedenen Produkten für verschiedene Anwendungsfälle gearbeitet werde, seien offene Schnittstellen „ein Muss“. Dazu müsse die Datenüberführung ins Facility Management (FM) bedacht werden, wo klassischerweise Computer-Aided Facility Management (CAFM)-Systeme genutzt werden.
Ein Schwerpunkt des Labors liegt in der Verbindung von BIM mit Internet of Things (IoT)-Sensorik für Smart-Building-Anwendungen. In diesem Kontext werden offene Austauschformate, Datenintegration und semantische Interoperabilität erforscht – ein Bereich mit großem Potenzial, gerade für die öffentliche Hand. Wichtig seien laut Prof. Bartels Fragen wie: „Welche Daten sind wirklich relevant? Welche Standards setzen wir ein? Und wie stellen wir sicher, dass sie über das ganze Projekt eingehalten werden?“ Auch organisatorisch erfordere die Lehre ein abgestimmtes Curriculum und regelmäßigen Austausch im Kollegium – insbesondere, da die TGA und die Architektur in verschiedenen Fakultäten angesiedelt seien.
Internationale Zusammenarbeit und Digitale Zwillinge im Fokus des BIM-Labors
Ein Highlight für das BIM-Labor ist das internationale BIM-Projekt mit der University of Auckland. Studierende beider Hochschulen arbeiteten in einer hybriden, immersiven Umgebung gemeinsam an Brückenbauwerken. Laut Prof. Niels Bartels hat sich gezeigt, dass Zeitverschiebung und unterschiedliche Semesterzeiten keine Hürde darstellen, solange beide Seiten offen sind und gemeinsam etwas voranbringen wollen.
Auch das Thema Digitale Zwillinge ist längst in Forschung und Lehre angekommen. An der TH Köln werden Modelle mit Facility-Management- sowie IoT- und Gebäudeautomationsdaten verknüpft. Erweiterte Realitäten dienen zur Visualisierung, hinzu kommen Forschungsarbeiten zu Simulationen mit Digitalen Zwillingen.
Wesentlich bleibt jedoch der Praxisbezug: In Kooperation mit Unternehmen arbeitet die Hochschule daran, Digitale Zwillinge – insbesondere durch die Integration dynamischer Daten – in reale Anwendungsfelder des Facility Managements zu übertragen.
Ausbildung für die digitale Baupraxis
Das BIM-Labor ist eng in die Lehre eingebunden: „Wir nutzen unterschiedliche Infrastruktur in unseren Modulen im Studiengang. Neben den klassischen Rechnern und Softwareprodukten setzen wir aktuell zunehmend mobile Lösungen, wie z. B. Virtual- und Augmented Reality (VR-/AR-)Lösungen in der Lehre ein“, so Prof. Bartels. Das betreffe nicht nur die „klassischen“ Module, die sich direkt mit BIM-Methodik, Prozessen und Software befassen, sondern auch die Grundlagenmodule wie Bauphysik und Baukonstruktion. „So haben wir bereits Aspekte der Baukonstruktion oder Bauphysik als AR-/VR-Umgebung gestaltet, und aktuell wird ein BIM-Modell einer Tunnelbohrmaschine in die Umgebung integriert. Dies fördert den interdisziplinären Gedanken, da wir verschiedene Kolleginnen und Kollegen, teils auch fakultätsübergreifend, in die Erarbeitung dieser Lösungen einbeziehen.“
Ein weiteres Beispiel: Im Mastermodul „BIM im Brücken- und Ingenieurbau“ lernen Studierende modellbasierte Objektplanung, Leistungsverzeichnisse, Kalkulation und Projektsteuerung. Ergänzt wird das Angebot durch Module zu digitalen Technologien im Lebenszyklus, Bauinformatik sowie zu offenen Datenformaten. Die Ausstattung des BIM-Labors kann auch von Studierenden für die Erstellung von Projekt- und Abschlussarbeiten genutzt werden.